Vom Nachttisch geräumt
Vorurteile sind Projektionen
Von Arno Widmann
15.02.2016. Selbstidentität ist eine Schimäre: Das zeigt Karl Löwiths Versuch, den Japanern in die Seele zu schauen. Wer an Vorurteile denkt, der denkt an Ansichten, die sich gewissermaßen unterhalb der Bewusstseinsschwelle herausbilden, Überzeugungen, die man übernimmt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Daneben wird aber an vielen Stellen auch ganz bewusst an der Herstellung von Vorurteilen gearbeitet. Hans Magnus Enzensberger sprach von der Bewusstseinsindustrie. Sie sorgt dafür, dass alles seinen Gang geht, dass nicht ausgeschert wird. Ich weiß: Ich bin einer ihrer kleinen Angestellten. Ich weiß auch: Der Versuch, sich über etwas klar zu werden, erzeugt schon durch die Fokussierung Unschärfen am Rand. Vorurteile entstehen nicht nur. Vorurteile werden auch gemacht. Propaganda zum Beispiel ist einer der Orte, an denen Vorurteile erzeugt werden. Nicht nur, wie meist betont wird, dadurch, dass Propaganda Vorurteile predigt, sondern auch dadurch, dass sie bestimmte, vielleicht nicht einmal falsche Beobachtungen verallgemeinert und über ihnen die "entgegenwirkenden Ursachen" vergisst.
Wer an Vorurteile denkt, der denkt an Ansichten, die sich gewissermaßen unterhalb der Bewusstseinsschwelle herausbilden, Überzeugungen, die man übernimmt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Daneben wird aber an vielen Stellen auch ganz bewusst an der Herstellung von Vorurteilen gearbeitet. Hans Magnus Enzensberger sprach von der Bewusstseinsindustrie. Sie sorgt dafür, dass alles seinen Gang geht, dass nicht ausgeschert wird. Ich weiß: Ich bin einer ihrer kleinen Angestellten. Ich weiß auch: Der Versuch, sich über etwas klar zu werden, erzeugt schon durch die Fokussierung Unschärfen am Rand. Vorurteile entstehen nicht nur. Vorurteile werden auch gemacht. Propaganda zum Beispiel ist einer der Orte, an denen Vorurteile erzeugt werden. Nicht nur, wie meist betont wird, dadurch, dass Propaganda Vorurteile predigt, sondern auch dadurch, dass sie bestimmte, vielleicht nicht einmal falsche Beobachtungen verallgemeinert und über ihnen die "entgegenwirkenden Ursachen" vergisst. Der Philosoph Karl Löwith, ein Schüler Husserls und Heideggers, lehrte 1936 bis 1941 an der Universität im japanischen Sendai. 1943 schrieb er die kurze Abhandlung "Der japanische Geist - Ein Porträt der Mentalität, die wir verstehen müssen, wenn wir siegreich sein wollen." Es handelt sich um eine sozialpsychologische Studie, die den Japanern in die Seele schauen möchte, um die Stellen auszumachen, an denen die Alliierten, vor allem also die USA, den Feind treffen können. Löwith betont das gespaltene Bewusstsein der Japaner. Auf der einen Seite sind sie modern und ultramodern, auf der anderen aber eingebunden ins alte Japan, in seine Traditionen und Überzeugungen.
"Die Japaner leben in zwei Etagen. Ganz japanisch im Erdgeschoss und halb verwestlicht im Obergeschoss. Das Ergebnis dieser mangelhaften Integration ist eine zwiespältige Haltung zur westlichen Zivilisation. Unfähig, sie vollständig zu durchdringen, fühlen die Japaner sich von ihr abhängig und ihr dennoch überlegen. Sie bewundern und imitieren sie, aber verachten sie auch und fühlen so gleichzeitig Minderwertigkeit und Überlegenheit."
Das ist sicher nicht nur klug beobachtet, sondern auch richtig. Es fallen einem Hunderte, diese These illustrierender Beispiele ein. Aber man traut dem Braten nicht. Dass Löwith als Beleg für die Rückwärtsgewandtheit der Japaner ausgerechnet das Reisetagebuch des Wanderpoeten Basho anführt, ist nicht zu begreifen. Unter dem Titel "Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland" ist es in der großartig kommentierten Übersetzung von Geza S. Dombrady seit 1985 in immer wieder neuen Auflagen in einer sehr schön gestalteten Ausgabe von der Dieterichschen Verlagsbuchhandlung in Mainz zu beziehen. Das vorgeblich so ganz und gar japanische Buch erfreut sich also auch in dem nach Löwith so völlig anderen Westen großer Beliebtheit.
So ganz anders scheint der Westen, gerade wenn man Löwiths "Analyse" liest, nicht zu sein. Man kann sie schließlich nicht lesen, ohne an Deutschland und die Deutschen, ohne an die unzähligen Zeugnisse zu denken, die nahezu gleichlautend ihm und ihnen ausgestellt wurden. Auch die Idee, Japan habe den Westen sklavisch imitiert und erst sehr spät eine eigene industrielle Identität entwickelt, erinnert an die Rolle die das ursprünglich ja nicht als Empfehlung, sondern als Warnschild gedachte "Made in Germany" in der Geschichte der Industrialisierung Deutschlands spielte. Löwith weist auch darauf hin, dass Japan einst in kultureller Abhängigkeit von China stand. Es dient ihm zur Unterstreichung des zerrissenen Charakters der Japaner. Dabei hätte dieser Blick zurück in die Geschichte doch den Schluss nahe gelegt, dass Japan bereits Erfahrung damit hatte, sich freizumachen von Übervätern, dass also doch einiges dafür spräche, dass Japan das auch diesmal gelingen könnte. Dem großen Kenner der europäischen Geistesgeschichte Karl Löwith fiel an dieser Stelle auch nicht ein, dass der große Aufschwung, der im 18. Jahrhundert zur klassischen deutschen Philosophie und Dichtung führte, aus Adaption und Abwehr französischer und englischer Vorbilder entstanden war. Löwith war befangen in seinen Projektionen, in seinem Vorurteil.
Und noch etwas: Sollte Karl Löwith, den die Nationalsozialisten als Juden verfolgten, als er "unfähig, sie vollständig zu durchdringen, fühlen die Japaner sich von ihr abhängig und ihr dennoch überlegen. Sie bewundern und imitieren sie, aber verachten sie auch und fühlen so gleichzeitig Minderwertigkeit und Überlegenheit" hinschrieb, tatsächlich nicht an die antisemitischen Diskurse der Zeit gedacht haben? Man muss in seinem Text doch nur "Juden" statt "Japaner" schreiben und schon befindet man sich mitten in der Auseinandersetzung darum, wie weit es möglich ist, eine andere Kultur zu assimilieren, wie weit es möglich ist, "in zwei Etagen zu leben". Bestritten wurde diese Möglichkeit ja nicht nur von Antisemiten. Es gab auch Juden, die in der Aufnahme der christlichen Kultur, die ja schon damals so christlich nicht mehr war, einen Verrat am Judentum sahen und in der Vermischung der beiden Welten ein Übel. Der Leser fragt sich, warum Löwith diese offensichtliche Parallele nicht erwägt, nicht einmal zu sehen scheint. Er projiziert womöglich die eigene Seelenverfassung, oder doch ein gut Teil davon, auf die Japaner.
Aber so spezifisch ist das alles ja nicht. Der Unterlegene fantasiert sich gerne in eine Überlegenheit hinein. Manchmal kommt ihm der militärisch-wirtschaftlich Überlegene dabei sehr weit entgegen. Man denke an das Verhältnis Roms zu Griechenland. Wir finden heute ganz ähnliche Vorstellungen, wenn es um das Verhältnis USA - Europa geht. Da wird dann europäischerseits gerne postuliert, "Amerika", gemeint sind die USA, müsse "befreit" werden "durch den überlegenen Reichtum europäischer Sitten". Als habe das Vorbild der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung keinen Einfluss auf die französische Erklärung der Menschenrechte gehabt, als wäre nicht im zwanzigsten Jahrhundert Europa mehrfach durch den Import amerikanischer Sitten befreit worden. Es kommt noch etwas hinzu. Das macht Löwiths Erklärung zwar noch plausibler, schwächt sie aber genau dadurch auch. Es gibt nämlich wohl keine Nation, die nicht in dem von Löwith beschriebenen Konflikt lebt. Einerseits das Neue, das man sich von irgendwo her nimmt oder zusammenbastelt, andererseits das Alte, in dem man aufgewachsen ist. In Wahrheit analysiert Löwith also nicht japanische Verhältnisse, sondern er entdeckt in ihnen, ohne es zu merken, allerallgemeinste Prinzipien, die nicht einmal nur auf Menschen, nicht einmal nur auf Lebewesen zutreffen. Die hinter Löwiths vermeintlicher Analyse spukende Vorstellung von Selbstidentität ist eine Schimäre, ein Vorurteil. Es hat sie nirgends - zu keinem Zeitpunkt - gegeben. Keine Gesellschaft ist mit sich selbst identisch. Kein Individuum ist es.
Ernst Bloch sprach in den 20er Jahren von der "Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen". Das war für ihn mal der Schlüssel, um die Strahlkraft des Faschismus zu verstehen, dann aber auch die Chance, sich dem später von Alexander Kluge so benannten "Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit" zu widersetzen. Man nennt das Ambivalenz. Worin Löwith das Manko der japanischen Kultur sah, das war in Wahrheit ihre Chance. Selbst das Gefühl der Minderwertigkeit kann zu einem Antrieb werden. Nicht nur für Militarismus (Nationalsozialismus) und Terrorismus (islamische Welt). Die Erfahrung der Niederlage und des Scheiterns kann auch den Weg ins Freie eröffnen. Vorausgesetzt, er wird von den Siegern nicht nur zugelassen, sondern auch bereitet. Das ist die Erfahrung der Bundesrepublik Deutschland und Japans. Das kann, wenn wir es wollen, auch die Erfahrung des Nahen Ostens werden.
Karl Löwith: Der japanische Geist, aus dem Englischen von Alexander Brock mit einem kenntnisreichen und klugen Vorwort von Lorenz Jäger, Matthes & Seitz, 80 Seiten, 10 Euro. Buch bestellen bei buecher.de.
Kommentieren








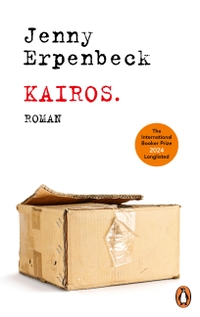 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung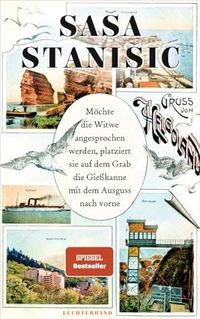 Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne
Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne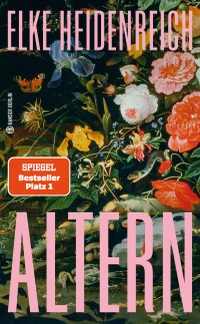 Elke Heidenreich: Altern
Elke Heidenreich: Altern